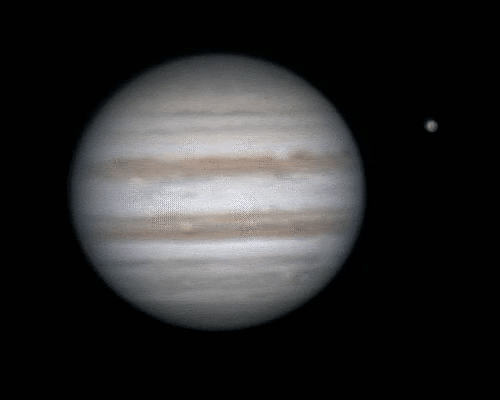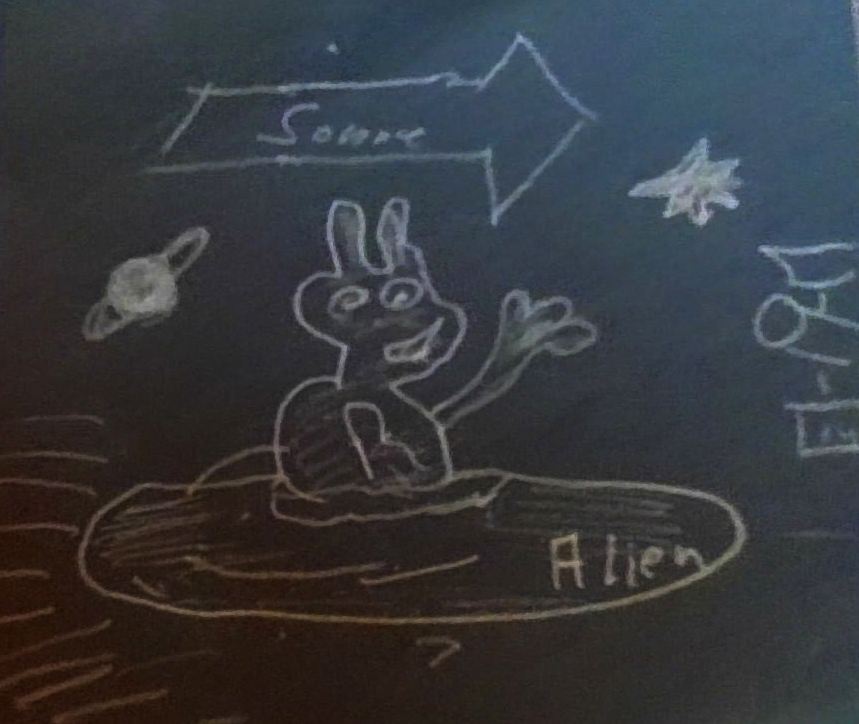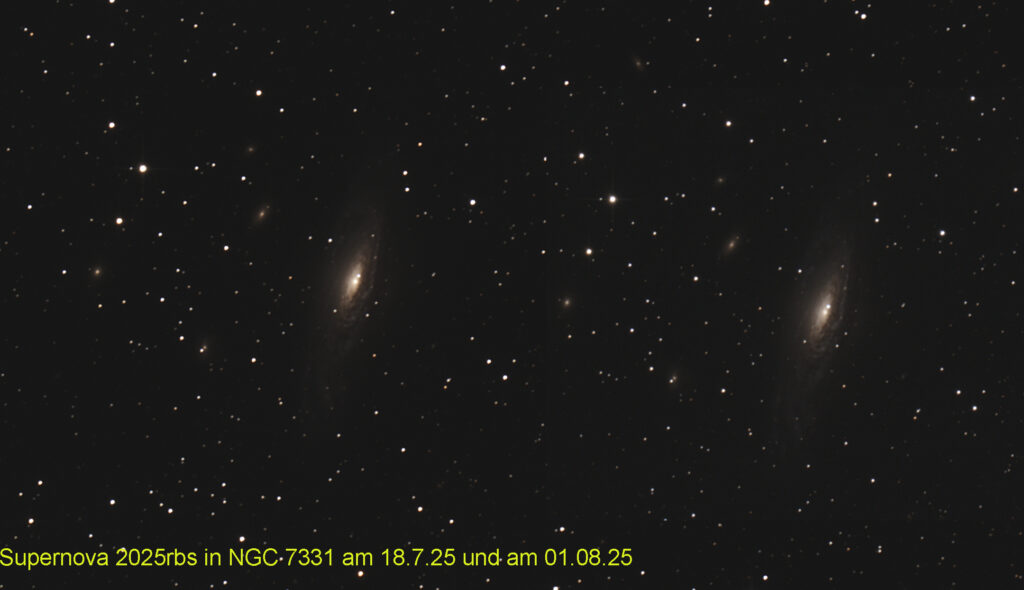Sollte am Abend des 19. Januar, ganz zu Beginn des Jahres, das spektakulärste Himmelsschauspiel des Jahres stattfinden? Womöglich! Am Abend des 18. Januar gegen 18Uhr (UT) beobachtete das Sonnenobservatorium GOES einen starken Ausbruch auf der Sonne, der einen koronalen Massenauswurf zur Folge hatte. Die Experten sprachen von einem Long duration-Flare der Klasse X1.9 mit einem Full Halo-CME. Das bedeutet, dass eine Menge elektrisch geladener Teilchen mit hoher Geschwindigkeit auf dem Weg zur Erde waren. Die Warnung vor Polarlicht galt für die nächsten 24 bis 48 Stunden. Bereits am Nachmittag des 19. Januar kündigte sich der eintreffende Teilchenstrom am EPAM-Instrument des ACE-Satelliten an. Das EPAM detektierte eintreffende Protonen. Vor dem Impakt der Hauptteilchenwolke steigen die Protonenzahlen stark und rampenförmig an. Irgendwann trifft dann die Schockwelle des Sonnewinds auf den ACE-Satelliten und die Sonnenwindwerte steigen dann stark an. Mit 1600 km/s waren diese Teilchen sehr schnell unterwegs und trafen bereits in den frühen Abendstunden mit der Dämmerung bei uns ein. Im Polarlichtforum von Meteoros liefen schon seit Stunden heiße Diskussionen. Und so begab ich mich schon kurz vor dem Impakt an einen dunkeln Ort, der aus meiner Sicht geeignet war. Das Schwarze Venn zwischen Heiden und Reken versprach eine gut Stelle für die Polarlichtbeobachtung zu sein. Der Ort ist einigermaßen dunkel und nach Norden gab es keine nahe Stadt. Allenfalls die Autobahn musste man etwas aus dem Bild verbannen. Der Himmel war dank eines Hochdruckgebiets übrigens klar und der Mond sollte den Himmel auch nicht aufhellen. Dort angekommen , stellte ich die Kamera auf und machte einige Bilder zur Kontrolle. Ich musste aber feststellen,dass ich weder ein Ersatzakku , noch die Powerbank für die Objektivheizung dabei hatte- ein blöder Anfängerfehler. Aber was solls. Im Nachhinein war das auch nicht so schlimm. Auf den ersten Aufnahmen konnte ich tief im Norden einen roten Schimmer erkennen, direkt neben einer helleren Lichtquelle, die vielleicht von der Raststätte Hochmoor der Autobahn herkam.

„Schon blöd“, dachte ich. Polarlicht genau neben einer anderen Lichtquelle. Aber es blieb ja nicht dabei. Mit jeder Minute wurde die rote Fläche größer und mit einem Male wurde das Polarlicht auch für das menschliche Auge sichtbar. Das sah schon toll aus. Es war aber wegen der Werte des Sonnenwinds schon zu erwarten. Was allerdings in den nächsten Stunden ab 21 Uhr bis 0:30 Uhr geschah, das hatten nur wenige so erwartet. Das Polarlicht am 19. Januar übertraf an Intensität das Polarlicht vom 11.Mai 2024 . Helle Polarlichtbänder im Zenit waren zu sehen. Polarlicht im Sternbild Orion. Der Himmel glühte im Norden durchweg grün. Rote Beamer erschienen und verblassten. War ich wirklich in Reken ? Der Himmel erinnerte an Island oder Norwegen.

Die Kamera machte gottseidank eigenständig ihre Aufnahmen, so dass ich euphorisch die Polarlichter beobachten konnte. Es waren Minus 2 Grad , aber mir wurde nicht kalt. Ich bin irgendwie in den Rausch verfallen. Während der hellen Phase gegen 22:30 Uhr näherte sich mir tatsächlich ein Auto. Ein Polarlichtsuchender war noch unterwegs . Nach kurzem Gespräch wollte er los um seine Kamera zu holen, die noch in Heiden war. Es ist zwar schön Gleichgesinnte zu treffen, aber nur, wenn sie etwas defensiver mit ihren Autoscheinwerfern umgehen.

Auch an einsamen Orten ist man ja nicht allein. Über den Polarlichtchat der Meteoros-Gruppe und der Sternfreundegruppe spürte man die Begeisterung anderer Sternfreunde. An der Sternwarte waren auch einige Beobachter. So ist das in der digitalen Welt. Man steht im Austausch mit vielen Anderen. Gegen Mitternacht ließ die Aktivität dann nach . Sie war immer noch sehr hoch, aber weil der folgende Tag ein Dienstag war und der nicht arbeitsfrei war, brach ich gegen halb 1 ab. Meine Akkureserven waren auch pünktlich erschöpft. Die Objektive musst ich zwei,drei Mal mit der Autoheizung trocknen.

Der Dienstag war ein müder Tag. Die Aktivität des Sonnenwinds war aber noch hoch. Ich war hin und hergerissen. Sollte ich lieber schlafen gehen oder nochmal los? Ich packte alles zusammen und fuhr ins Schwarze Venn. An meinem Beobachtungsplatz stand ein Traktor, der hell beleuchtet arbeitete . Damit hatte ich nicht gerechnet. Es war ja schon 19:30 Uhr. Aber egal, ich fuhr einige hundert Meter weiter, bog in einen Feldweg ab und postierte mich völlig abgelegen an eine Wieseneinfahrt. Auf den ersten Aufnahmen konnte man das Polarlicht gut erkennen, dann auch wieder visuell. Es war weitaus schwächer als am Tag zuvor. Dennoch war es schön. Nach der ersten Welle wartete ich noch auf Weiteres . Aber es blieb dabei. Gegen 21 Uhr kamen noch zwei junge Männer mit dem Auto vorgefahren, stellten ihre Kameras auf. Sie wollten ebenfalls dem Spektakel beiwohnen. Laut ihrer App auf dem Handy sollte Polarlicht zu sehen sein. Ein Karte mit Sichtungen , die gerade oder nur wenige Minuten alt waren, sah man auf dem Display ihres Handys. Ich hatte schon seit einer halben Stunde nichts mehr gesehen. Auch das Polarlichtforum konnte keine Sichtungen melden. Das ist schon verwunderlich. Ich habe keine Ahnung, was die Leute da gesehen haben. Polarlicht wird es nicht gewesen sein. Ich packte meine Sachen jedenfalls zusammen, zumal der Himmel immer wolkiger wurde. In der Nacht zum Mittwoch gegen 0:30 Uhr ist anscheinend wohl noch mal Aktivität zu sehen gewesen. Bei uns war der Himmel aber bewölkt. Also hatte ich nichts verpasst.

Dieses besondere Polarlichtevent wurde von vielen Menschen gesehen und auch in den Medien geteilt. Viele Menschen werden begeistert gewesen sein und einige von ihnen werden auch zukünftigen Polarlichtern hinterher jagen. Diese großen Ereignisse sind hier aber sehr selten. Die hellsten Polarlichter , die ich gesehen habe, waren das Halloween-Polarlicht im Jahr 2003 am 30/31.10 2003, das Polarlicht im Mai 2024 und dann jenes Polarlicht am 19. Januar 2026. Viele kleine Polarlichtbeobachtungen, die meisten davon nur photographisch, waren zu beobachten. Oft waren diese sehr hübsch anzusehen. Die großen Ereignisse verschlagen einem aber einfach die Sprache.